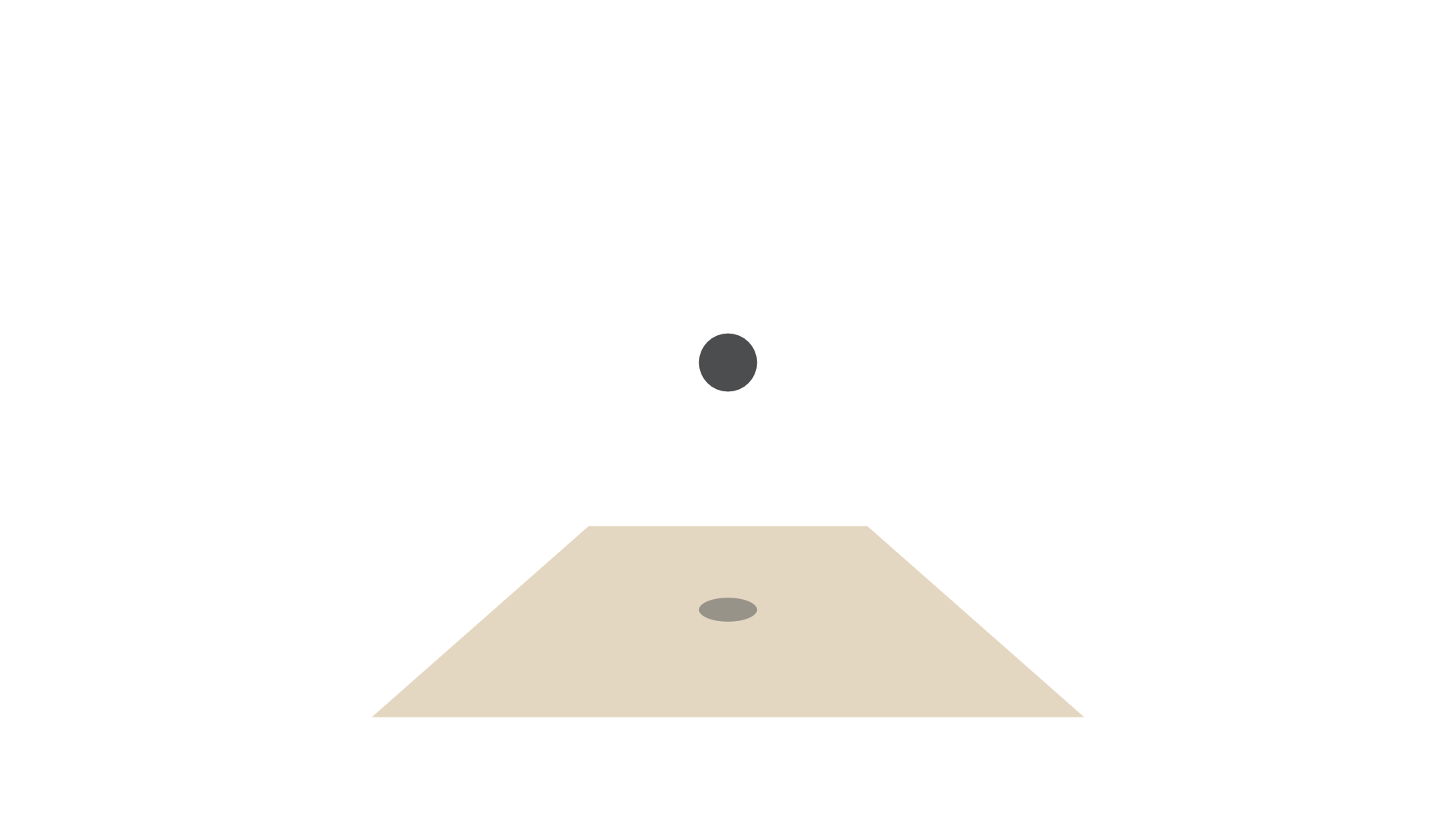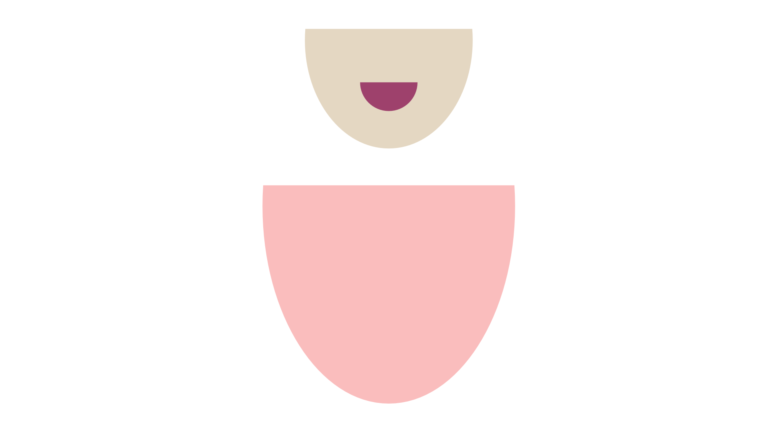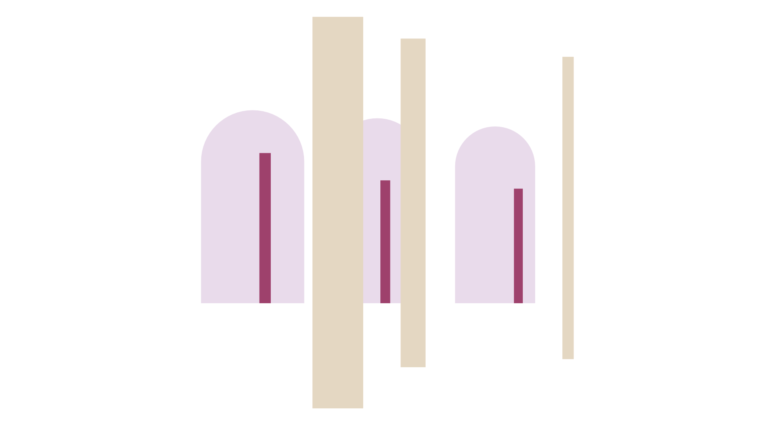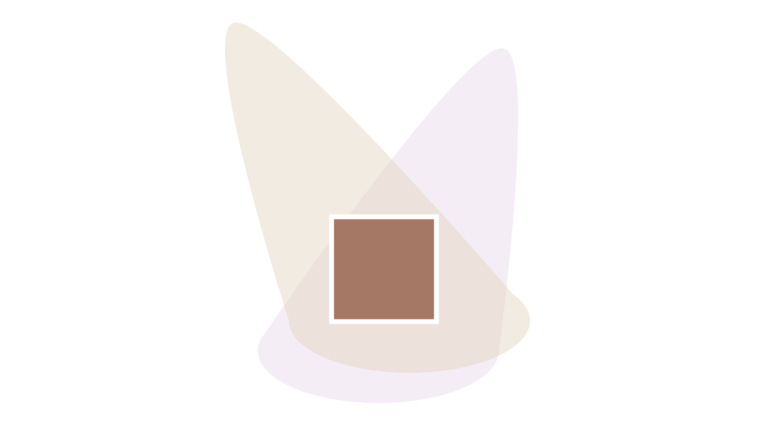Was steckt psychologisch gesehen hinter dem Megatrend Minimalismus?
Spätestens seit Marie Kondōs Bestseller «Magic Cleaning» kennt so ziemlich jeder und jede den minimalistischen, aufs wesentliche reduzierte Wohntrend. Die grossen Versprechen dabei sind Einfachheit, Klarheit, Ordnung und Struktur. Während andere Einrichtungsstile schnell wieder verschwinden, hält sich dieser Trend seit Jahren hartnäckig. Es scheint also ein grösseres psychologisches Bedürfnis dahinterzustecken.
Minimalismus in der Architektur
In der Architektur hat die Strömung des Minimalismus ihre Wurzeln in der klassischen Moderne der 1920er Jahren. Und bis heute bildet sie ein Ideal für viele zeitgenössische Architektinnen und Architekten. Es geht dabei nicht nur um Funktionalität, sondern auch um Materialgerechtigkeit, also eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Eigenschaften von Materialien und dessen bewusster Einsatz. Dazu kommen möglichst reduzierte, einfache Formen, frei von Ornamenten und Dekorationen. Wir finden dies zum Beispiel in Gebäuden von Ludwig Mies van der Rohe, John Pawson oder Tadao Ando.
«Weniger, aber besser.»
Dieter Rams, Designer
Minimalismus im Interior Design
Beim Einrichtungstrend ist die Auslegung nicht ganz so streng. Deko ist erlaubt, solange sie Freude macht und damit auch einen Zweck erfüllt. Dennoch liegt der Fokus auch hier auf Reduktion: wenige, funktionale und mit Bedacht ausgesuchte Möbelstücke in einem eher leeren Raum. Die Farbwelt ist meistens neutral gehalten, Weisstöne, Schwarz und natürliche Materialien wie Holz, Stahl oder Beton.
«Just enough.»
Naoto Fukasawa, Designer
Bedürfnis nach Erholung
Das Ziel einer minimalen Einrichtung ist also Reduktion, Einfachheit und Struktur. Ein so eingerichteter Raum minimiert die Eindrücke, die unser Gehirn verarbeiten muss. Er vermittelt Ruhe und kann in einer Welt voller Reize, Ablenkung und Zerstreuung eine Insel der Erholung darstellen. Menschen, die sich von Minimalismus angesprochen fühlen, sind oft überreizt und brauchen zum Ausgleich einen reizarmen Ort. So können sie strapazierte Nerven beruhigen und wieder ins Gleichgewicht finden.
Bedürfnis nach Einfachheit
Mit seiner Klarheit stellt der Minimalismus auch einen Gegenpol zur Komplexität der Welt dar. Überkonsum, technische Entwicklungen und Kommunikation auf immer mehr Kanälen tragen dazu bei, dass die Welt immer komplexer erscheint. Viele Menschen fühlen sich davon überfordert und sehnen sich nach mehr Einfachheit. Die Komplexität kann Angst machen und das psychologische Grundbedürfnis nach Kontrolle ansprechen. Der Minimalismus vermittelt mit Ordnung und Struktur genau dies und stärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Gerade in Zeiten von Krisen oder Umbrüchen kann ein geordnetes Zuhause Halt geben und das Gefühl vermitteln, das Leben im Griff zu haben.
Bedürfnis nach Selbsterkenntnis
Wir sind uns unserer ganz persönlichen Identität oft nicht bewusst, bis wir uns aktiv damit auseinandersetzen. Dazu gehört, die eigenen Werte zu erkennen, Position zu beziehen und zu wissen, was wir brauchen und was nicht. Beim Minimalismus wird genau dieses Bewusstsein geschärft. Es geht um eine aktive Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Gegenstand. Und zwar so lange, bis nur noch die Essenz an Dingen übrig bleibt, die zu der eigenen Identität und Lebenssituation passt. Obwohl es vordergründig um materialistische Dinge geht, schwingen immer auch Werte, Erinnerungen und Hoffnungen mit. Vielleicht erkennt man in dem Moment, dass etwas den eigenen Werten widerspricht, dass eine Phase im Leben unwiederbringlich vorbei ist oder eine Hoffnung enttäuscht wurde. Deshalb ist Aussortieren emotional anstrengend. Es ist aber auch eine Gelegenheit, etwas loszulassen und neuen Raum zu schaffen – auf materieller und auf psychologischer Ebene.
Die Kehrseite
Minimalismus kann auch extreme Züge annehmen und zu einer Art Religion werden. Es kann zum Zwang werden, immer weniger besitzen zu wollen. Die geschaffene Leere bietet dann nicht mehr den Raum für persönliche Entfaltung, sondern wird starr und einschränkend. Durch die Strenge geht die Lebensfreude verloren. Ein spontaner, irrationaler, aber freudiger Kauf wird so im Keim erstickt. Dabei wäre es vielleicht genau dieser Gegenstand, der einen Teil der eigenen Identität widerspiegelt. Selbst Marie Kondō hat sich inzwischen von dem extremen Minimalismus distanziert.
Stil vs. Idee
Ein minimalistischer Stil und Minimalismus ist nicht dasselbe. Mit Schwarz, Weiss und klaren Linien kann ein Raum minimalistisch gestylt sein, ist aber nicht unbedingt zweckmässig. Andererseits kann ein Raum bunt und verspielt aussehen, und dennoch genau die Essenz der Persönlichkeit, also die Idee des Minimalismus, widerspiegeln.
«Architektur ist im besten Fall Ausdruck von Wahrheit.»
Peter Zumthor