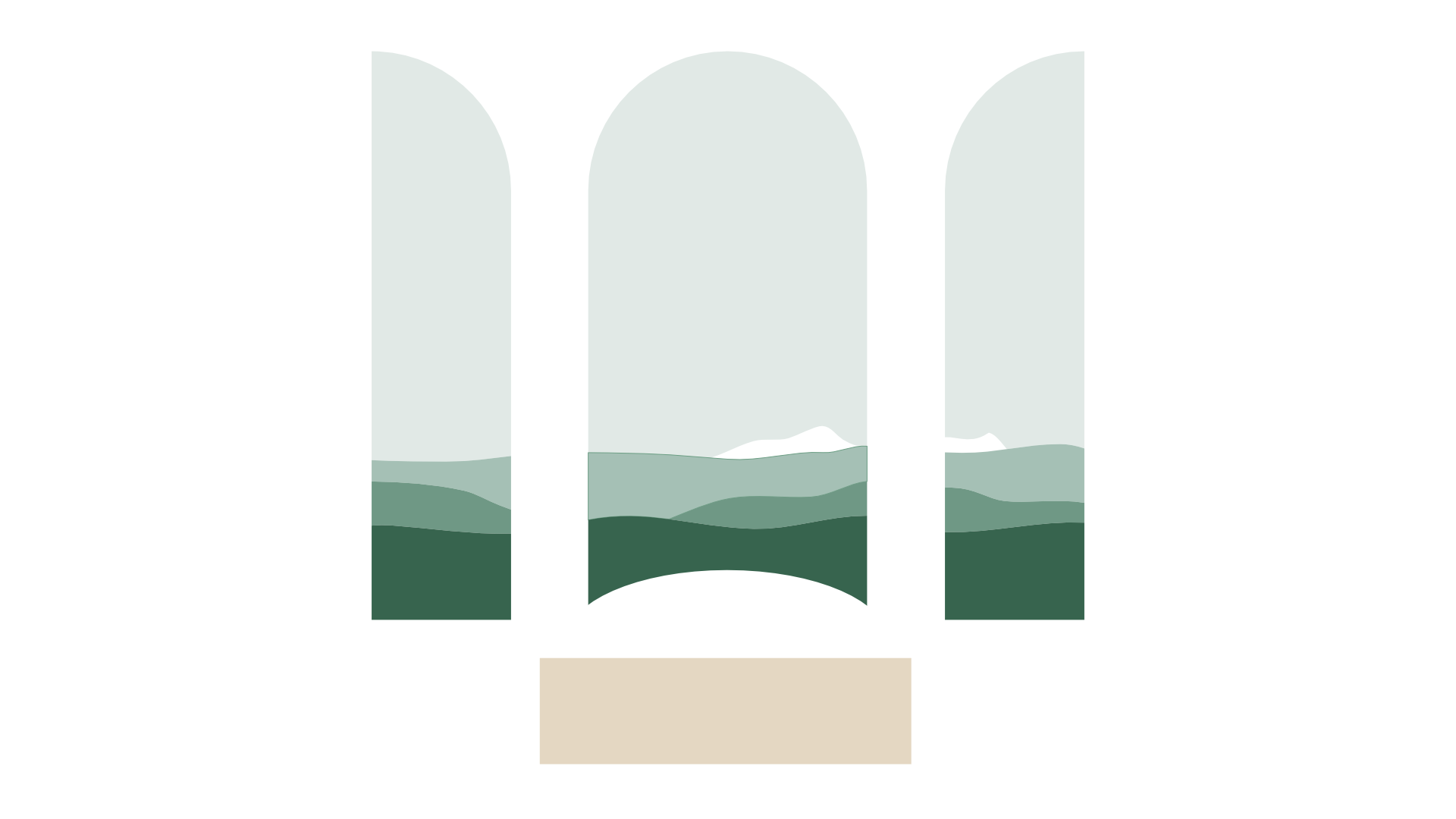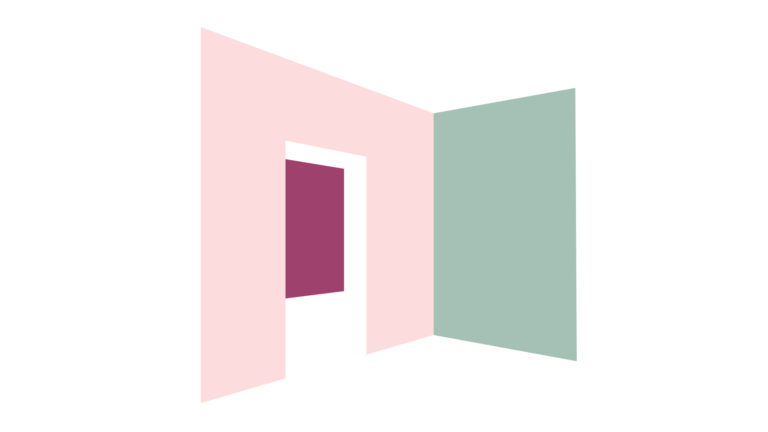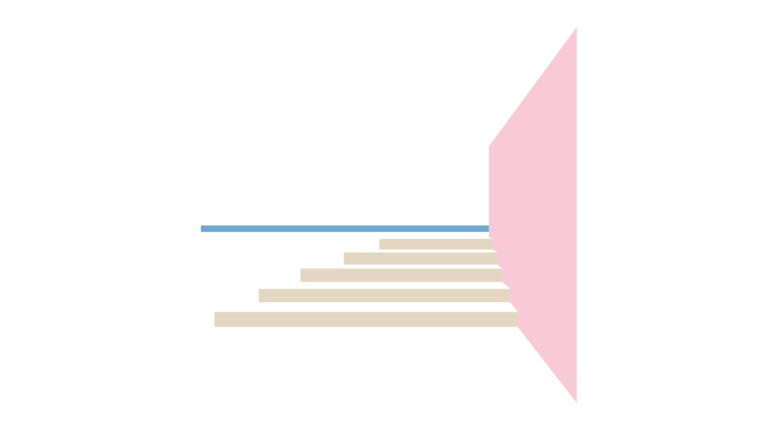Wie unterstützt «Healing Architecture» unsere Gesundheit?
Wer krank oder verletzt ist, reagiert besonders sensibel auf seine Umgebung. Gleichzeitig ist die Bewegungsfreiheit dann oft eingeschränkt. Die Räume, in denen man sich in einem so empfindlichen Zustand aufhält, haben also einen besonderes grossen Einfluss auf das Wohlbefinden.
Optimale Voraussetzungen
Das Konzept der Healing Architecture setzt genau dort an. Es optimiert die Raumgestaltung so, dass die besten Voraussetzungen für eine Genesung geschaffen werden. Das Ziel ist, die physischen und psychischen Belastungen von Patientinnen und Patienten zu reduzieren und eine Atmosphäre zu erzeugen, die stresslindernd und emotional ausgleichend wirkt. Dazu werden alle Aspekte der Raumgestaltung berücksichtigt, wie Licht, Farben, Materialien, Akustik, Ausblick, die Anordnung von Räumen und ihre Proportionen.
Perspektive der Nutzenden
Die Patientinnen und Patienten sind eine wichtige, aber nicht die einzige relevante Nutzergruppe in Gesundheitsbauten wie Spitälern. Ebenfalls entscheidend ist die Zufriedenheit des Personals. Auch für sie muss das Gebäude eine optimale Umgebung schaffen. Dazu gehören unter anderem effiziente Abläufe, funktionierende Technik und Rückzugsmöglichkeiten, um wieder neue Kraft für den nächsten Einsatz tanken zu können. Die beiden Haupt-Nutzergruppen beeinflussen sich zudem gegenseitig: Ein zufriedener Patient benötigt weniger intensive Betreuung und entlastet das so Personal, eine zufriedene Ärztin kann sich besser konzentrieren und besser kommunizieren, wovon wiederum der Patient profitiert. Eine gesundheitsfördernde Architektur kann also sowohl die Heilung als auch die Arbeit daran leichter machen.
Aspekte der Gestaltung
In seiner klassischen Forschungsarbeit hebt der Umweltpsychologe Roger Ulrich drei Faktoren hervor, die die Heilung positiv beeinflussen: Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung und angenehme Ablenkung. Umgekehrt lösen Kontrollverlust, soziale Isolation und fehlende Zerstreuungsmöglichkeiten Stress aus, der die Heilung behindert. Selbstwirksamkeit bedeutet, Patientinnen und Patienten können die Räume an ihre Bedürfnisse anpassen, sich gut orientieren und hindernisfrei bewegen sowie ihre Privatsphäre zum Beispiel über Vorhänge schützen. Die soziale Unterstützung kann gefördert werden, indem es attraktive Treffpunkte wie ein Café, einen Garten oder einen Sportbereich gibt. Auch zufriedenes und freundliches Gesundheitspersonal trägt dazu bei. Bei der Ablenkung geht es um eine Verschiebung des Fokus. Dieser dreht sich bei Patientinnen und Patienten oft sehr um das eigene Kranksein. Ablenkung hilft dabei, aus diesen negativen Gedankenspiralen auszubrechen und den Fokus immer mal wieder auf Angenehmeres zu richten. Dazu gehört besonders das Erleben von Natur. Es fördert die Heilung sehr effektiv, wirkt ausgleichend und hebt die Stimmung. Der Einsatz von Pflanzen zum Beispiel ist unter dem Schlagwort «Biophilia» gut erforscht und sehr wirksam.
Beispiele
Das Konzept der «Healing Architecture» wird inzwischen bei vielen Neu- oder Umbauten im Gesundheitsbereich angewendet. Im Felix Platter Spital in Basel zum Beispiel fördern Farben das Wohlbefinden und helfen bei der Orientierung. Sie stützen sich auf Empfehlungen der Arbeitsgruppe Health Care Communication Design. Ein weiteres Beispiel ist der Neubau der Kinderklinik in Freiburg im Breisgau. Er wurde auf Basis von qualitativen Raumkonzepten geplant, die die Spezialistinnen von Kopvol entwickelt haben. Oder, gerade fertiggestellt, das neue Kinderspital in Zürich von Herzog & de Meuron.
Anwendung
Selbstverständlich heilt ein schöner Raum alleine kein gebrochenes Bein. Das Wichtigste ist noch immer gutes Gesundheitspersonal und die entsprechende Infrastruktur. Aber die Räume können als ein Baustein in der Behandlung angesehen werden. Sie können die Heilung behindern oder fördern und sollten deswegen bewusst gestaltet werden. Wenn sie über ihre Atmosphäre ausgleichend wirken und Selbstwirksamkeit, soziale Kontakte und Ablenkung ermöglichen, regen sie die Selbstheilung an. So tragen sie quasi nebenbei zur Heilung bei und entlasten damit auch das Gesundheitssystem.
Quellen: Ulrich, R. S. (1991). Effects of healthcare environmental design on medical outcomes. Healing Architecture and Evidence-Based Design.