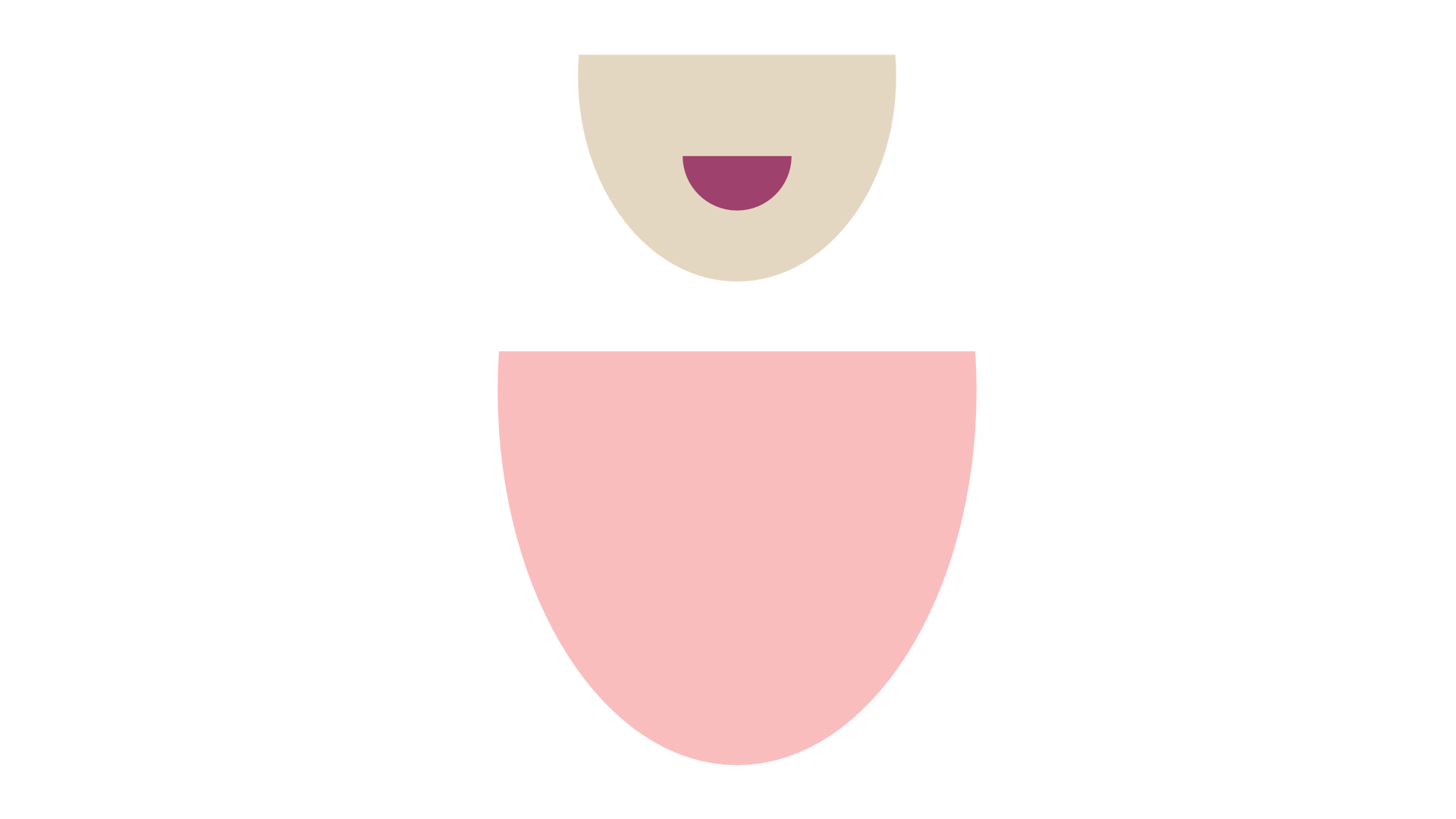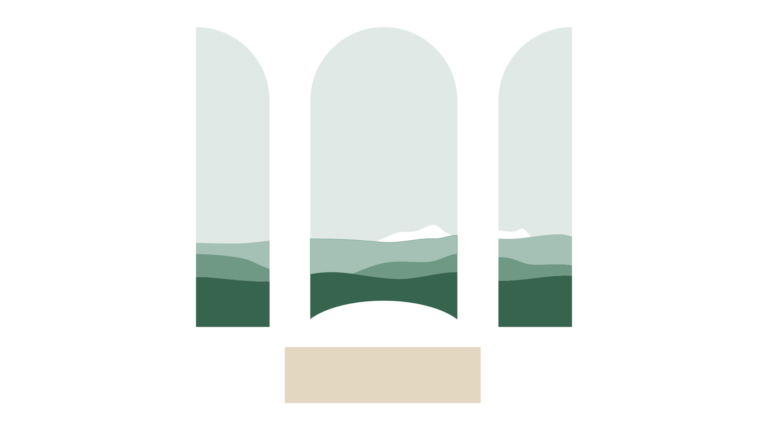Heute gehen wir zurück ganz zum Beginn unseres Lebens. Wir schauen uns an, was die allerersten Raumeindrücke sind, die Neugeborene wahrnehmen können und welche Prozesse bei der Geburt ablaufen. Dazu habe ich mir professionelle Unterstützung von Sabine Ihle geholt. Sie ist Psychotherapeutin und spezialisiert im Bereich der Neonatologie.
Sabine, wie nehmen Babies die Geburt und den Wechsel von ihrem allerersten Raum, dem Bauch der Mutter, in den Aussenraum wahr?
Der Übergang für Babies von der Gebärmutter in den Aussenraum ist eine tiefgreifende Veränderung, vermutlich die tiefgreifendste Veränderung, die Babies im Rahmen ihres ersten Lebensjahr erleben. Diese Veränderung spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, physisch sensorisch und auch emotional. Und wenn wir genauer hinschauen, dann sind die Babys perfekt auf diesen Übergang vorbereitet.
Physisch gibt es einen grossen Temperaturunterschied. In der Gebärmutter ist die Temperatur konstant auf 37°C reguliert. Nach der Geburt, im Aussenraum, ist es, je nach Kultur und Jahreszeit, im Normalfall etwas kühler. Das Baby muss sich an die kühlere Temperatur anpassen und die Körpertemperatur selbst halten. Zudem gibt es einen Druckunterschied. In der Gebärmutter spürt das Baby mit den Kopf, den Händen, den Füsschen, eigentlich mit den ganzen Gliedmassen die Gebärmutter als Begrenzung. Diese Begrenzung gibt dem Baby intrauterin Halt, extrauterin fällt sie weg. Das gibt dem Baby natürlich Bewegungsfreiheit, aber es bedeutet auch eine Verunsicherung, weil weniger Halt vorhanden ist. Eine weitere grosse Veränderung findet im Bereich der Atmung statt. In der Gebärmutter wird der Sauerstoff über die Nabelschnur zugeführt. Während der Geburt wechselt das Baby dann zur Lungenatmung und atmet zum ersten Mal selbstständig.
Was sich für das Baby beim Übergang in den Aussenraum auch massiv verändert, sind die sensorischen Reize. Das Licht war in der Gebärmutter eher dunkel, gedämpft, indirekt. Man spricht auch vom Inkarnat, also von einem leichten Rosé-Lila Farbton, den die Babys erleben. Nach der Geburt ist das Licht dann direkt, je nachdem sehr hell und die kindlichen Augen sind noch empfindlich. Auch die Geräusche verändern sich. Der Klangpegel intrauterin ist geprägt durch den Herzschlag der Mutter, durch ihren Blutfluss und auch durch die Stimme der Mutter und die anderen Geräusche. Sie dringen nur gedämpft zum Kind.
Je nachdem wie die Geburt verläuft, kann das Baby einem starken Druck und sensorischen Reizen ausgesetzt sein. Nach der Geburt ist es mit ganz unterschiedlichen Oberflächen konfrontiert, mit dem Hautkontakt durch die Eltern, mit verschiedenen Berührungen, mit unterschiedlichen textilen Oberflächen, mit dem ersten Bad.
Der Geburtsprozess bedeutet für das Baby einen grossen Stress. Hier helfen hormonelle Mechanismen wie zum Beispiel Endorphine, die freigesetzt werden, um dem Baby zu helfen, den Übergang zu bewältigen. Und auch vertraute Reize, die Stimmen der Eltern, der Geruch der Mutter und der vertraute Herzrhythmus helfen dem Baby, den Übergang von intrauterin zu extrauterin zu bewältigen und sich auch im ersten Aussenraum geborgen und sicher zu fühlen.
Wie müsste der Raum gestaltet sein, um dies zu unterstützen?
Der primäre Raum für das Neugeborene ist während dem ganzen ersten Lebensjahr ein Bindungsraum. Von daher ist es noch gar nicht wichtig, welches Kinderzimmer das Kind hat, sondern in welchem Raum sich die Eltern sicher und geborgen fühlen, um diese Sicherheit und Geborgenheit an das Kind weitergeben zu können. Natürlich braucht auch das Kind extrauterin bestimmte Bedingungen in Bezug auf Licht, Wärme und Geräusche, unter denen es gut gedeihen kann. Neugeborene sind erstaunlich gut auf die Aussenwelt vorbereitet. Sinne wie das Tasten, das Hören oder auch der Geruch und der Geschmack sind sind sehr weit entwickelt. Das Sehen und der Gleichgewichtssinn entwickeln sich kontinuierlich. Alle Sinne arbeiten zusammen, damit das Baby die Interaktion mit der neuen Umgebung gestalten kann.
Der Sehsinn ist bei der Geburt noch am wenigsten entwickelt und erst eingeschränkt vorhanden. Für das Neugeborene ist die ideale Distanz, um etwas zu sehen, circa 20-30 cm. Das ist auch die normale Distanz, die die Mutter während dem Stillen hat. Das Neugeborene bevorzugt Gesichter und folgt mit den Augen am liebsten dem lachenden Mund. In den ersten Lebenswochen kann es nur schwarz-weiss sehen, ungefähr ab der vierten Lebenswoche dann auch in Farbe.
Welche Besonderheiten gibt es bei Frühgeborenen?
Die Sinne bei den Frühgeborenen sind zum Teil noch unreif und noch nicht voll funktionsfähig. Darum sind die frühgeborenen Kinder noch viel mehr auf Unterstützung angewiesen. Sie brauchen noch Unterstützung beim Halten der Wärme, über den Inkubator oder das Wärmebett. Meistens oder phasenweise wird das Licht abgedunkelt, weil die Augen noch empfindlicher sind. Sie bekommen noch Unterstützung bei der Atmung und bei der Nahrungsaufnahme, sie sind auch sensorisch viel empfindlicher. Das heisst, der Geräuschpegel auf der Neonatologie wird gezielt ruhig gehalten mit möglichst wenigen lauten oder überraschenden Geräuschen.
Wie können also Inkubator und auch ganze Neonatologie-Stationen so gestaltet werden, dass es dem frühgeborenen Kind und seiner Familie dient? Auf der Neonatologie werden drei grosse Ziele verfolgt. Zum ersten die physiologische Stabilität des Kindes, also dass es warm genug ist, dass es atmen kann, dass es ausreichend ernährt wird. Dann seine sensorische Entwicklung, also dass sich die vorher beschriebenen Sinne weiterentwickeln können. Und das dritte grosse Ziel ist der Aufbau einer sicheren Eltern-Kind-Beziehung. Um die Ziele zu erreichen, orientiert man sich an der Schutz und Beruhigung schenkenden Gebärmutter. Man spricht auch von der Neonatologie als einer extrauterinen Gebärmutter, wo die Wärme reguliert wird, das Licht und die Geräusche kontrolliert werden und die medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig werden die Eltern maximal in die Betreuung ihres Kindes integriert und mitversorgt. Wir sagen, nicht nur das Kind ist frühgeboren, sondern die ganze Familie, also die ganze Familie ist der Patient und alles, was die Eltern an Geborgenheit, Sicherheit und Informationen erhalten, können Sie auch an das Kind weitergeben.
Zusammen mit Julia Krohn hat Sabine Ihle das Kinderbuch «Kraken kennen keine Berge» herausgebracht, welches das Thema Frühgeburt kindgerecht vermittelt und zur spielerischen Verarbeitung anregt. Sabine Ihle arbeitet als Psychotherapeutin in ihrer eigenen Praxis in Bern.
Links